Archaischer Damm in der Bucht von Akraiphia
(Archaik, 800 - 500 v. Chr.)
Voraussetzungen
Das Hochwasserableitungssystem der Minyer war in der archaischen Zeit
gestört, jedoch noch nicht entscheidend geschädigt. Es kann
daher ein temporär gutes bis mäßiges Funktionieren,
mit zeitlichen Verschlechterungen, vorausgesetzt werden. Der Kopaisse
fiel bei guter Witterung weiterhin im Sommer trocken.
Trockenlegung der Bucht von Akraiphia zur Landgewinnung
In Nachahmung minyscher Polderbauten wurde ein Deich in der Bucht von
Akraiphia errichtet, der diese gegen den See absperrte. Er wird aufgrund
seiner Konstruktion, die deutlich die Kopie der äußeren Form
minyischer Deichbauten ist, in eine spätere Zeit, die Archaik,
datiert. Die Architektur dieses Bauwerkes wird von Knauss als Meisterleistung
bezeichnet, als wasserbauliche Maßnahme war er ein technischer
Fehlschlag (1).
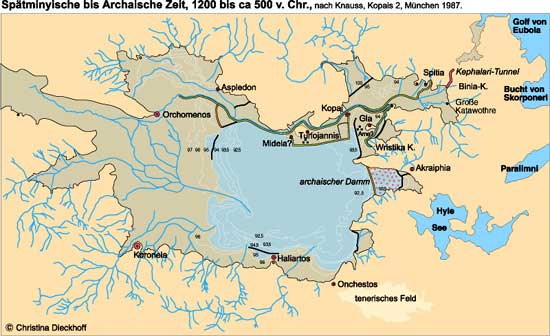
vergrößern
Die Trasse an der Bucht war so ausgewählt, daß ein geringer
Aufwand an Bauhöhe nötig war. Vorbilder waren vermutlich minyische
Buchtenabriegelungen im Norden und Süden der Baustelle, also die
Polderdämme von Gla und Medeon. Diese Bucht wurde von den Minyern
jedoch absichtlich offengelassen, da sie die wichtgsten Vorfluter zur
Abführung der winterlichen Seehochwasser und zur Trockenlegung
der Beckenmitte enthielt, nämlich zwei leistungsfähige Katawothren
am Südrand, sowie eine Reihe von Sinklöchern
im mittleren Teil des Seitentales. Die große Katawothre Palaiomylos
(=Alte Mühle) wurde mehrere 100 m ins Innere hinein künstlich
kanalisiert durch Höhlengänge und Nischenausmauerungen (2).
 Die
Deichmauer bestand aus massiven Kalksteinblöcken, die in polygonaler
Fügung zusammengesetzt wurden. Wegen des nicht mehr vorhandenen
Wissens um die leichteren, lehmgedichteten Steinmauern der Minyer war
die Folge, daß wegen des hohen Gewichtes der Kalksteinblöcke
hydraulische Grundbrüche entstanden. Es kam zu Setzungen einzelner
Mauerpartien, die Steine verlagerten sich gegenseitig, so daß
klaffende Fugen entstanden. Der Damm konnte daher nicht über längere
Zeit dichthalten. Er wurde zweimal repariert. Die erste Version war
die Hinzufügung einer Mauer aus Porosquadern, die jedoch
ein ähnliches Schicksal erlitt wie der ursprüngliche Damm.
Diese Maßnahme hatte also nur kurzzeitigen Erfolg. Das Wissen
um die Technik der minyischen Wasserbauten scheint zu dieser Zeit endgültig
verloren gewesen zu sein (3). Die
Deichmauer bestand aus massiven Kalksteinblöcken, die in polygonaler
Fügung zusammengesetzt wurden. Wegen des nicht mehr vorhandenen
Wissens um die leichteren, lehmgedichteten Steinmauern der Minyer war
die Folge, daß wegen des hohen Gewichtes der Kalksteinblöcke
hydraulische Grundbrüche entstanden. Es kam zu Setzungen einzelner
Mauerpartien, die Steine verlagerten sich gegenseitig, so daß
klaffende Fugen entstanden. Der Damm konnte daher nicht über längere
Zeit dichthalten. Er wurde zweimal repariert. Die erste Version war
die Hinzufügung einer Mauer aus Porosquadern, die jedoch
ein ähnliches Schicksal erlitt wie der ursprüngliche Damm.
Diese Maßnahme hatte also nur kurzzeitigen Erfolg. Das Wissen
um die Technik der minyischen Wasserbauten scheint zu dieser Zeit endgültig
verloren gewesen zu sein (3).
Folgen
Diese Maßnahme war vor allem Schuld an der Verschlechterung der
Hochwasserverhältnisse der Kopais in späterer Zeit. Der Zugang
zu den größeren Katawothren war nun versperrt, so daß
die Hochwässer in Folge um einiges schlechter abfließen konnten.
Grundsätzlich scheint das System jedoch noch intakt gewesen zu
sein. Dies zeigen weitere Maßnahmen aus dieser Zeit in der Bucht
von Akraiphia.
Weitere Maßnahmen in der Bucht von Akraiphia
Dort werden von Ulrichs 1840 sieben Schächte genannt, die sich
unten wie Zisternen erweitern. Sie wurden von Fiedler, einem Geologen,
1836 ebenfalls erwähnt, jedoch nicht bei Phillipson 1890. Ulrichs
schreibt: "Es breitet sich nehmlich wenige Fuss unter dem fruchtbaren
Boden innerhalb dieser Bucht eine harte Steinkruste aus, unter der lockeres
und poröses Flöz liegt, wie schon Strabon im allgemeinen von
Böotien vermerkt. Man braucht hier deshalb bloss die obere Kruste
zu durchbrechen, damit sich das Wasser in dem durchlöcherten Flöz
verlaufen konnte."
Diese Schächte sind durch die heutige, intensive landwirtschaftliche
Nutzung der Kopais eingeebnet worden. Ihr Vorhandensein und ihr Zweck
wird von Knauss jedoch nicht bestritten. Zeitlich werden sie von ihm
nach der Entstehung des archaischen Dammes als Ausgleichsmaßnahme
für seine Fehlfunktion, bis spätestens in die Zeit des 1.
Jahrhunderts n. Chr. eingeordnet, weil später durch fortschreitende
Sedimentation der Seeumfang zunahm und solche Maßnahmen nicht
mehr den gewünschten Erfolg bringen konnten.
Am Isthmos, einem kleinen Kalksteinrücken, der die Bucht von Akraiphia
von der Ebene am Hyle-See trennt, gab es einen weiteren Versuch zur
Rettung des Systems. Ein künstlicher Einschnitt von bis zu 30 m
Tiefe und beträchtlicher Breite soll hier angelegt worden sein.
Er folgt als offener Graben der tiefsten Einsattelung und endet plötzlich
in einer senkrecht aufsteigenden Felswand. Beobachtungen wurden hierzu
von Leake, 1835, Ulrichs, 1840 und von Phillipson, 1894 gemacht, jedoch
nicht weiter verfolgt. Der Beweis für einen menschlichen Eingriff
steht hier noch aus.
©Christina Dieckhoff 2001
__________________________
(1): Knauss, Kopais 2, S. 243.
(2): Knauss, Kopais 2, S. 246-47.
(3): Knauss, Kopais 2, S. 248.
|