|
|
Kopais
Deichbauten
|
|
|
Erste Eindeichungen zur Landgewinnung
(Mittelhelladikum ca. 2000 - ca. 1550 v. Chr.)
In der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. gab es im Kopaisbecken
einen ganzjährigen See, der im Winter eine Tiefe von 2,5 m hatte.
Sie reduzierte sich bei entsprechender Witterung im Verlauf des Jahres
auf etwa 1 m. Im Winter stand das Wasser bis zur Höhenlinie 95
m, im Sommer bis zur Höhenlinie 93,5 m. Zuflüsse des Melas
und der Herkyna glichen im Sommer zum größten Teil die Verdunstungsverluste
aus. Der geschätzte mittlere Seegrund lag bei 92,5 m.
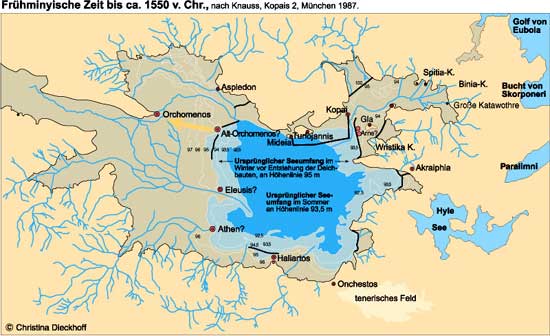
Bild vergrößern
Siedlungen dieser Zeit lagen am Westrand des Kopaissees auf sogenannten
Schwemmfächern
ab der Höhenlinie 95 m und darüber. Als Anreiz zu deren Gründung
mag der Fischreichtum des Sees, die landwirtschaftlich verfügbare
Fläche im Hinterland und die besondere Fruchtbarkeit des Bodens
gedient haben. Des weiteren gab es auch Siedlungen auf den felsigen
Inselbergen, Halbinseln und Vorsprüngen des Gebirgsrandes im Bereich
der Nordostbucht. Von Winter bis Frühjahr, der für das Pflanzenwachstum
günstigsten Zeit, kam es zur Seeausdehnung durch Hochwasser. Im
Sommer, der ungünstigeren Wachstumsperide, fiel der Kopaissee allmählich
wieder trocken. Nach Pausanias (1) und Strabon (2) sind in der Antike
noch Siedlungen an der Mündung von Triton, Phalaros, Melas und
Herkyna Siedlungen überliefert. Diese sind nach Knauss durch Bruchstücke
sogenannter grauminyscher
Keramik am Westrand der Kopais nachgewiesen (3).
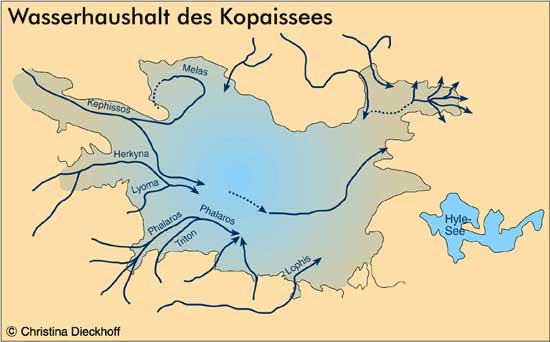
Wasserhaushalt
Wie anhand der Karte deutlich zu erkennen ist, hat der Kopaissee
mehrere Zuflüsse (Kephissos, Melas, Herkyna, Phalaros, Triton und
andere). Durch sein Relief - der Kopaissee ist ein nach allen Seiten
hin abgeschlossenes Becken mit zum Teil steil aufragenden Kalkfelsen
- kann das Wasser oberirdisch nicht abfließen. Der leicht wasserlösliche
Kalkstein in schräger Schichtlage ermöglichte durch Lösungsvorgänge
und Verwitterung einen unterirdischen Wasserabfluß an der Ost-
und Nordostseite des Kopaissees. Es entstanden gut sichtbare Höhlen
am Seerand, für jeden Beobachter gut sichtbar floß das Seewasser
zum Beispiel durch die größte Höhle - die große
Katawothre - in der Nordostbucht ab. Diese Bucht fiel gegen Ende der
Wachstumsperiode trocken (4).
Landgewinnung
Daher begann man schon zu dieser Zeit mit wasserbaulichen Maßnahmen
und fing an, den See aus manchen Buchten auszusperren und auf der Höhenlinie
95 m 1 m hohe Dämme relativ einfacher Bauweise gegen Hochwasser
anzulegen (5), um so geschützte Flächen für die Landwirtschaft
zu haben. Bei normalen Hochwässern reichten diese baulichen Maßnahmen
zur Landgewinnung völlig aus. Der Nachweis dieser frühen Bauten
ist nicht in jedem Fall einfach, da, wie Knauss vermutet, einige der
nach 1529 v. Chr. entstandenen Bauten mit Sicherheit auf ihren Vorläufern
errichtet und von diesen ersetzt wurden (6). So vermutet Knauss, daß
der 6 km lange Damm des Polders
bei Turlojannis bereits im Mittelhelladikum entstanden
sei, was durch Scherbenfunde in diesem Gebiet zu belegen sei (7). Ein
2 km langer Damm entstand in der sogenannten Bucht von Davlos (Medeion)
im Süden der Kopais. Er diente ebenfalls zur Errichtung eines Polders
und damit der Landgewinnung, ebenso der Polder in der Kapsorouti-Bucht
nördlich von Kopai (8). Ein Damm in der Bucht hinter der Felseninsel
von Gla lag auf der Höhenlinie 96 m und diente vermutlich der Errichtung
eines künstlichen Sees als Trink- und Brauchwasserspeicher für
die nahegelegene Siedlung und für die Bewässerung der Felder
(9). Die auf den Inselbergen gelegenen Siedlungen werden zu Akropolen
der wegen der Zunahme der Bevölkerung in dieser Zeit neu errichteten
Unterstädte in den eingedeichten Poldern. Beispielsweise gibt es
einen 1 km langen, 500 m breiten Geländestreifen am Deich des Gla-Polders
in 500 m Entfernung zu Gla, der laut Knauss Indizien für Siedlungsreste
aufweist (10). Ein analoger Fund wäre im Polder am Fuß des
Nisi von Strowikion zu erwarten, muß jedoch noch durch Grabungen
bewiesen werden, da keine Scherben an der Oberfläche zu finden
sind. Diese sind vermutlich mit Seeablagerungen von mindestens 0,75
m Stärke überdeckt (11).
Diese Art von Wasserbauten ist zu dieser Zeit schon im gesamten Griechenland
nachzuweisen. Knauss vermutet, dass es sehr unwahrscheinlich sei, daß
ein ausgereiftes und funktionierendes System, wie es nach 1550 entstand,
aus dem Nichts entstand (12). Neben dem Wissen über die genauen
örtlichen Gegebenheiten und die Technik der lehmbedichteten Steinmauern
müssen daher schon Vorläuferbauten existiert haben. Die ersten
Dämme waren jedoch wohl noch nicht systematisch in größerem
Zusammenhang angelegt (13).
©Christina Dieckhoff 2001
_______________
(1): Pausanias, 9,24,2 und lX, 30, 11.
(2): Strabon, 9,2,18 und 9,2,42
(3): Knauss, J.: Die Wasserbauten der Minyer in der Kopais,
(Kopais 2), München 1987, S. 103.
(4): Knauss, Kopais 2, S. 103.
(5): Knauss, Kopais 2, S. 104; Knauss, J.: Die Wasserbaukultur
der Minyer in der Kopais. In: Boiotika.
Vorträge vom 5.
Internationalen Böotien-Kolloquium, München 1989, S. 266 -
67 und
Knauss, J.: Die Wasserbauten
der Minyer in der Kopais, München 1984, S. 205f.
(6): Knauss, J. Kopais 2, München 1987, S. 145f
(7): Knauss, J.: Wasserbaukultur, S. 268.
(8): Knauss, Kopais 2, S. 105-106., Knauss, Wasserbauten,
S. 205.
(9): Knauss, Kopais 2, S. 106.
(10): Knauss, Kopais 2, S. 106.
Eine ausführlichere
Beschreibung gibt es in Knauss, Wasserbaukultur, S. 213 - 226. (11):
Knauss, Kopais 2, S. 106.
(12): Knauss, J.: Kopais 2, S. 145 f.
(13): Knauss, J.: Kopais 2, S. 145 f. und S. 108.
|
|