Die frühhelladische Keramik ("Urfirnis") von Orchomenós
Umfangreiche Schichtgrabungen Bulles in den Jahren 1903 und 1905 haben
reiche Keramikfunde zu Tage gefördert. Die Funde aus dem Neolithikum
und dem Frühhelladikum wurden von Emil Kunze dokumentiert und interpretiert
[1]. Daraus ergibt sich, daß Orchomenós bereits seit dem
Neolithikum besiedelt war und diese Epoche um etwa 2500 v. Chr. mit
einer radikalen Zerstörung endete. Die hier beschriebene anschließende
frühhelladische Epoche
(frühe Bronzezeit) dauerte gute 500 Jahre, bis etwa um 2000 v.
Chr. auch ihre Kultur gewaltsam zerstört und ihre Bevölkerung
von den einwandernden Griechen unterworfen wurde.
Die vorgeschichtliche Bevölkerung der frühhelladischen Zeit
hat uns mit der sogenannten Orchomenós-Ware ein eindrucksvolles
Zeugnis ihrer Kultur hinterlassen. Zwar könnte ihre Keramik oberflächlich
betrachtet gegenüber der ornamentalen Vielfalt der Vorgängerkultur
zunächst ärmlich erscheinen, aber ihr großer Formenreichtum
und die handwerkliche Vollendung sind bewunderungswürdig.
Formenvielfalt
Besonders die einmaligen Formen der Hydrien (Wassergefäße),
der Kannen mit den Varianten der Askos- und der Trompetenkanne und der
Saucièren prägen sich als etwas ganz Besonderes ein. Humpen,
Kratere, Näpfe und Schalen (mit hohem Hals oder ausgeprägtem
Fuß), Askosbecher und Schüsseln (mit eingezogenem Rand oder
breiter Lippe) vervollständigen den Formenreichtum.
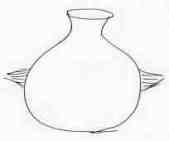 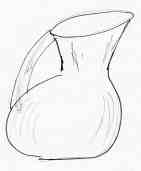 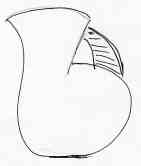 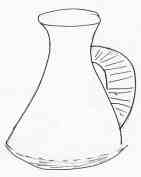
Prototypische Formen von Hydria, Askoskannen,
TrompetenkanneAbb. 8a-d)
Die bäuerliche Bevölkerung, die diese Töpferwaren schuf,
lebte in dörflichen Siedlungen mit ausgesprochen primitiven Wohnhäusern
(Rundbauten). Sie trieb regen Handel mit den Kykladen. Nach der gewaltsamen
Zerstörungen ihrer Siedlungen um 2000 ist manche ihrer Gefäßformen
in die folgende Zeit (Die minysche Keramik)
übergegangen.
Handwerkliche Qualität der Orchomenós-Ware
Die besten Stücke aus den frühen und mittleren Schichten
bestehen aus einem dichten, klingend hart gebrannten Ton, dessen Eigenschaften
auf einer niedrigen Ofentemperatur und auf einer besonderen Tonsorte
oder -mischung beruhen. Sie zeichnen sich durch ziemlich dünne
Gefäßwandungen und eine "wunderbar feste, gleichmäßig
aufgetragene Glasur aus, der ein intensiver, fast metallischer Glanz
eigen ist". Ihre Farbskala reicht von dunklem Rot, über Violett,
Rotbraun, leuchtendes Gelb bis zu dunklem Olivgrün; eine ausgesprochene
Vorliebe besteht für "ein reines, tiefes, bläuliches
Schwarz". Die Ausgräber fanden dafür den Ausdruck "Urfirnis".
Die Leuchtkraft der Keramik wurde in erster Linie durch sorgfältige
Politur erreicht. [2]
Leider sind die Funde im Museum von Chaironeia zur Zeit nicht zugänglich.
Ein Gutes Beispiel für eine Askoskanne findet sich aber im Museum
von Theben.
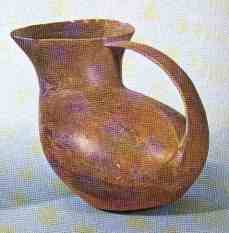
Askoskanne, frühhelladisch -Museum Theben, Vitrine
9 (Abb. 19)
[Zu einem späteren Zeitpunkt soll versucht werden, jeweils ein
typisches Exemplar einer Hydria, Askoskanne, Trompetenkanne und Saucière
zu lokalisieren und sie über Museumslinks oder Photos anschaulich
zu machen.]
Dokumentation der Funde durch Emil Kunze
Die Funde aus der Grabung Bulles von 1905 konnte erst 1934 von Emil
Kunze –unterstützt durch eine eigene Nachgrabung- dokumentiert
und interpretiert werden. Von den vorgestellten Fundbeispielen befanden
sich 1934 (Zeitpunkt der Dokumentation) etwa 80 % im Museum von Chaironeia,
die übrigen im Nationalmuseum Athen. Die entsprechenden Inventarnummern
dieser Museen sind bei Kunze vermerkt.
Siehe auch Anmerkungen zur systematischen
Einteilung und wissenschaftlichen Aufarbeitung der Keramik von Orchomenós.
(Peter Teuthorn)
_______________
1) Kunze, Emil: Orchomenos III, Die Keramik der frühen Bronzezeit,
München 1934.
2) ebd. S. 16-17.
|